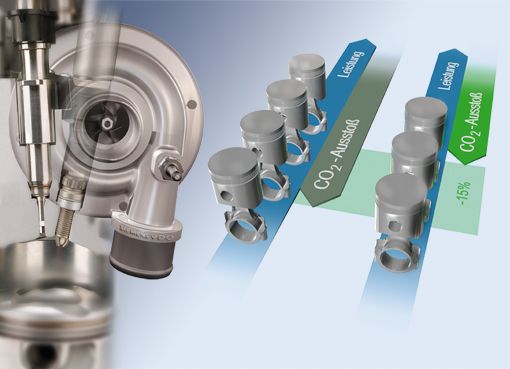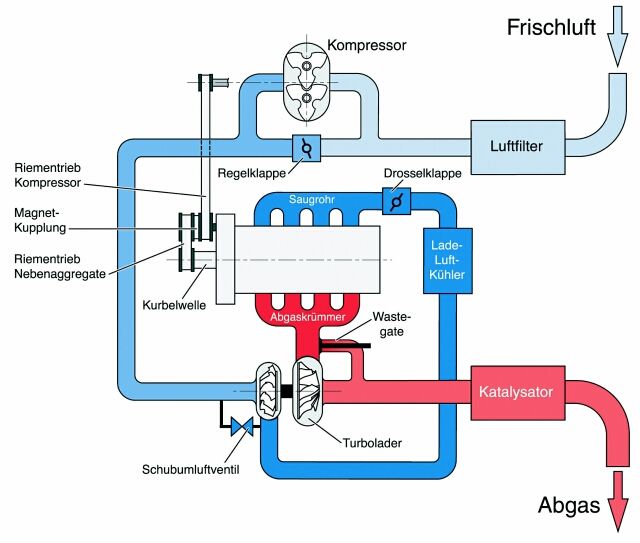|
|
Motor |
Die Aufladung beim Motor
|
Abgasturbolader |
Ladedruckregelung |
Ladedrucksteller VTG
|Füllung und Drehmoment|
Leistungssteigerung |Leistung
| Mehrventiler |
Variable Steuerzeiten | Valvetronic |
Vergleich P/M | Schaltsaugrohr
Die Aufladung beim Motor
Grundsätzlich gilt:
Bei der Aufladung wird die Ladungsmenge
vergrößert, also die Dichte der Ansaugluft erhöht, somit der
Füllungsverlust verkleinert und der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors
verbessert. Dies hat jedoch auch eine Temperaturerhöhung zur Folge. Mit
einem Ladeluftkühler vor dem Eintritt in den Motor, kann
eine weitere Steigerung der Ladungsmenge im Zylinder erreicht werden.
Mit Aufladung kann eine
bedeutende Drehmomentanhebung (mehr Arbeitsdruck) und
Leistungssteigerung erreicht werden.
Der im Vergleich zum Basis-Saugmotor leistungsgleiche
Ladermotor kann somit mit kleinerem Hubraum und daher geringerem
Gewicht ausgelegt werden. Man spricht vom Downsizing.
Durch die Aufladung können die gesetzlich
vorgeschriebenen Abgasemissionsgrenzwerte besser eingehalten
werden.

VW 1.4 TSI Turbo |
Laut Siemens sind mit Downsizing, also
statt vier nur drei Zylinder und statt dessen dafür mit
Direkteinspritzung und Turboaufladung Einsparungen von 15% realistisch.
|
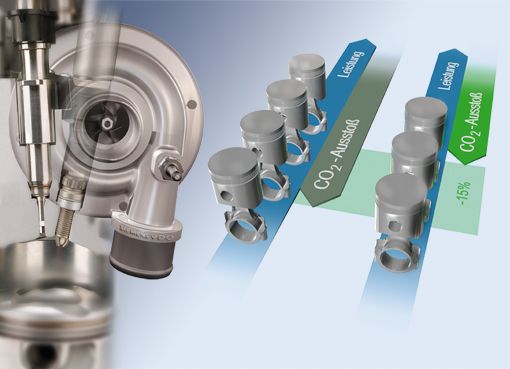
Siemens VDO |
bei Dieselmotoren gilt:
- hohe Verdichtung + Aufladung = sehr hohe
Arbeitsdrücke
- hohes Drehmoment + niedriger Verbrauch
|
|
Systeme:
-
Schwingrohraufladung
-
Abgasturboaufladung
-
kombinierte Aufladung oder Resonanzaufladung
-
mechanische Aufladung (Kompressor)
-
Druckwellenaufladung oder
Comprexaufladung
-
Pulseconverter
Man unterscheidet auch zwischen
Selbstaufladung
(z.B. Schwingrohraufladung) und der Fremdaufladung
mit einem Zusatzaggregat.
|
|
|
Warum
mechanische Aufladung ?
Besonders beim Ottomotor ergeben sich Vorteile gegenüber dem
ATL, weil die abgasführenden
Teile nicht aus hochwarmfesten, teuren, Material hergestellt werden
müssen. Die luftführenden Teile können in genügend großem Abstand zu
heißen Teilen angebracht werden und dadurch nicht aufgeheizt werden
können. Die Abgasturbine soll aus Wirkungsgradgründen möglichst nahe am
Auspuffkrümmer angebracht werden. Das verursacht thermische Probleme für
die übrigen angrenzten Motorteile und stellt große Anforderung an die
Abgasdichtungen. Die Abgasführung des Kompressormotors kann
strömungsgünstig und kostengünstig gestaltet werden.
Als Zusatzladegerät in
Serie zum ATL ist jedoch ein kompakter mechanischer Lader auch beim
PKW-Dieselmotor sinnvoll einsetzbar.
Auch bei Dieselmotoren mit Rußfiltern ergeben sich
Vorteile für den mechanischen Lader.
|
Bauarten der
mechanischen Aufladung
-
Kompressoraufladung:
Für die mechanische Aufladung von Verbrennungsmotoren
werden überwiegend Drehkolbenmaschinen in einwelliger und
zweiwelliger Ausführung verwendet. Wie bei den Zahnradgetrieben
(Außenverzahnung und Innenverzahnung) unterscheidet man bei den
zweiwelligen Maschinen zwischen außenachsigen und innenachsigen
Ausführungen. In der einfachsten Form besteht der Rotor aus einem
Kreiszylinder, das Gehäuse aus einem kreiszylindrischen Rohr, und das
Trennelement zwischen Saugraum und Druckraum aus einem federbelasteten
Flach-Schieber.
Die einwellige Bauart lässt sich gut und kompakt in den
Verbrennungsmotor einbauen. Der Antrieb kann auch ohne Riemen oder Zahnräder
erfolgen, wenn man den Rotor direkt mit dem Kurbelwellenende antreibt. Durch
das zentralsymmetrische Aneinanderreihen von mehreren Rotoren hintereinander
wird ein pulsationsarmer gleichmäßiger Förderverlauf erreicht. Es ist die
zweiwellige, außenachsige, verschraubte Bauart nach Roots, die derzeit am
häufigsten in Serie eingesetzt wird. Im Nachrüstmarkt wird zusätzlich der
mechanisch und elektrisch getriebene Radialverdichter und der
Schraubenverdichter eingesetzt.
Vor- und
Nachteile des mechanischen Laders
Vorteile:
Antrieb durch Motor - abschaltbar durch Magnetkupplung
- schneller Aufbau des Ladedrucks - hohes Drehmoment bei niedrigen
Drehzahlen
Nachteile:
schlechter Gesamtwirkungsgrad - Antrieb
kostet ca. 20 kW Antriebsleistung, nur Ladedruck bis 1,8 bar möglich
|
Turbo und Kompressor
VW kombiniert in ihrem TSI Modellen den Kompressor
mit dem Turbolader, um die Vorteile beider Systeme auszunutzen.
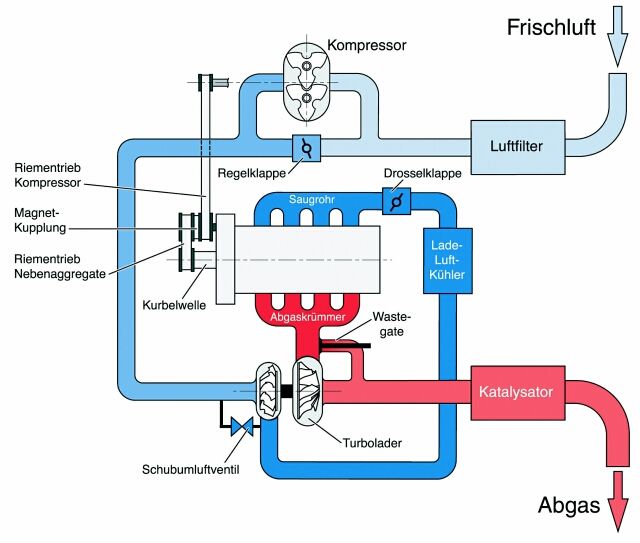
VW TSI Turbo Kompressor
Motortuning mit Aufladung
Das Tunen (Verbesserung von Leistung und Drehmoment von
Serienmotoren) mit Abgasturbolader und Kompressor ist sehr beliebt
und wirkungsvoll. Die einfachste Möglichkeit ist die "milde"
Aufladung mit mechanisch getriebenen, dauergeschmierten Ladern bis
max. 0,3bar Ladedruck. Durch den Verzicht auf höhere Ladedrücke und
damit höhere Leistungswerte kann gegebenenfalls der Ladeluftkühler,
Ölkühler und der Lader-Motorschmierölanschluss eingespart werden.
Der Umbau wird damit einfach gehalten werden. Auch die Lebensdauer
von Lader und Motor wird höher sein. Das Tunen mit dem
Abgasturbolader hat größeren Einfluss auf den Motor. An den
Motorteilen Abgaskrümmer, Auspuffanlage, und an der Motorschmierung
sind in jeden Fall Umbauten notwendig.
Begriff: "Turbodiesel"
Da bei den neuesten PKW - Dieselmotoren der
Abgasturbolader die Standardausführung ist (nur mehr wenige
Saugdiesel werden angeboten), wird dieser Begriff immer weniger in
der Fahrzeugbeschreibung und -bezeichnung verwendet. Auch das früher
so oft in der Abkürzung verwendete "T" für "Turbo" wird nur mehr
selten verwendet. So kann man bei der Bezeichnung Common Rail
Dieselmotor (CDI oder CR...) fast immer davon ausgehen das ein
Dieselmotor mit Abgasturbolader (Turbodiesel) im Fahrzeug eingebaut
ist. Also ein Turbodiesel mit dem neuen Einspritzsystem Common Rail.
Auch beim schlichten "D" für Diesel (früher die Bezeichnung für
Saugdiesel) muss man mit einem Abgasturbolader rechnen.
Wassereinspritzung beim aufgeladenen
Motor?
Die meist nur für getunte Motoren und
Rennmotoren angewandte Wassereinspritzung nutzt die hohe
Verdampfungswärme von Wasser. Auf den Ladeluftkühler, oder nach dem
Lader in die heiße Luft gesprüht, entzieht es dem Gehäuse und der
Ladeluft beim Verdampfen Wärme und bewirkt eine Abkühlung. (Je
kühler die Ladung ist, um so mehr Luftmasse passt bei gleichem
Volumen in den Verbrennungsraum!) Das bringt nicht nur einen
Leistungsgewinn, sondern auch (bei normaler Fahrweise)
Verbrauchsvorteile und Abgasverbesserung (NOx).
Arten der Ladeluftkühlung
Im Fahrzeugbereich (PKW, LKW) wird überwiegend
die Luft (Fahrtwind) - Luft (Ladeluft) -Kühlung angewendet. Der, im
Vergleich zur Ladeluft "kühle", Fahrtwind wird auf einen
Wärmetauscher geleitet, der mit der Ladeluft durchströmt wird. Stark
im Kommen ist aber der doch aufwendigere Wasser (Motorkühlwasser) -
Luft (Ladeluft) Kühler. Einen effektive Kühlung kann hier nur
erreicht werden, wenn das Motorkühlwasser vor dem Eintritt in den
Ladeluftkühler abgekühlt wird.
Infos und Bild-Quellen: VW,
Bugatti, Borg Warner, Wikipedia,
Dipl. Ing. Haider,
Auszüge aus
Wikipedia (GNU
freie Lizenz für Dokumentation)
Autor: Johannes Wiesinger
bearbeitet:
Folgen Sie
kfztech auf Twitter

Besuchen Sie kfztech auf Facebook
 |
|