Das
Auto besteht seit 100 Jahren im Kern aus einer Karosserie, einem Fahrwerk
und dem Antrieb. Technische Lösungen kamen und gingen und immer wurden von
uns Lehrern die neuen Bauteile genauer angesehen und uns gefragt:
-
Wie ist das Teil
aufgebaut? (Aufbau)
-
Wie funktioniert es?
(Funktion)
-
Was bewirkt es?
(Wirkungsweise)
Wer
ein Lehrbuch zur Kraftfahrzeugtechnik aufschlägt, findet die Beantwortung
dieser Fragen als Strukturelement wieder und so mancher Unterricht ist
entsprechend aufgebaut.
Die Vielfalt der technischen
Lösungen ist inzwischen explodiert und die Systeme im Auto werden mehr und
mehr vernetzt. Letztendlich kann weder in der Berufsschule noch im Betrieb
jede technische Innovation behandelt werden. Und das ist auch nicht nötig,
denn nicht jede technologische Entwicklung findet ihren Niederschlag in
einer Veränderung der Arbeitsanforderungen. Trotzdem scheint es, dass neue
technologische Entwicklungen immer wieder nach dem obigen Schema zu den
neu zu lernenden Inhalten erklärt werden.
Mit der Aussage eines BMW-Verantwortlichen wird dies konterkariert: „Von der 7er-Baureihe gibt es heute theoretisch 1017 Varianten.“ Müsste ein Kfz-Mechaniker sich all diesen Varianten widmen, so würde die Lehrzeit wohl die Lebensdauer eines Menschen übersteigen. Gerade im Kfz-Handwerk muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass solch ein additives Verfahren nicht angewendet wird, werden doch Fragen der Diagnose, der Informationsbeschaffung mit den neuen Medien und der Kundenorientierung etc. immer wichtiger.
Nun gibt es ja auch noch
andere Lösungen für den Umgang mit den immer neuen Technologien im Kfz,
z.B. das Systemwissen. Das Wissen um die allgemeine Funktion der Systeme
soll dessen Komplexität durch Selektion reduzieren. Lehrer können sogar
auf eine systemtheoretische Didaktik zurückgreifen. Gerade im
Kfz-Technologieunterricht ist die Systemorientierung weit verbreitet, da
diese doch eine erste Antwort auf die Informationsfülle gibt. Vielfach
führt ein solches Vorgehen jedoch zu einem Unterricht, der sich in seiner
Abstraktion sehr weit von den Arbeitsanforderungen entfernt. Das Resultat:
Es wird gelernt, was vielleicht schlauer macht, aber nicht gebraucht wird.
Ursache dafür ist, dass es während der Arbeit nie zur Anwendung gebracht
werden kann. Wenn jemand die Zahnrad-, Sichel- oder Flügelzellenpumpe den
Verdrängerpumpen und die Kreiselpumpe den Strömungspumpen zuordnen kann
(ein typisches Beispiel für den Strukturen schaffenden systemtheoretischen
Unterricht), führt dies noch lange nicht zu einer Steigerung seiner
Handlungskompetenz. Es fehlt der klare Bezug zur Arbeit. Ein zu niedriger
Öldruck oder ein aussetzender Motor aufgrund eines Defektes an der
Kraftstoffpumpe kann mit dem abstrakten Systemwissen nicht diagnostiziert,
ja nicht einmal reflektiert werden.
Neben der Zunahme an Varianten plagt uns die Elektronik im Automobil. Fast keine Funktion ist mehr zu finden, die nicht von der Elektronik beherrscht ist. Die Elektronifizierung der Autos führt zu einschneidenden Veränderungen der Technik. Ein Trugschluss ist aber, darauf hin die Elektronik zum Lehrfach zu erklären. Die Elektronik selbst ist nicht Gegenstand der Facharbeit. Weder das innere Funktionieren eines Mikrocomputers noch die Struktureigenschaften der Halbleiter muss man kennen, um ein Auto reparieren zu können. Das spiegelt sich letztendlich auch in der Kfz-Branche wieder. Weder die Zahl der Auszubildenden zum Kfz-Elektriker noch die Zahl der Elektrik-Betriebe sind durch den gewachsenen Elektronikanteil im Automobil angestiegen (siehe Diagramm). Im Gegenteil: Die Zahl der Auszubildenden bleibt relativ konstant und die Zahl der Elektrikbetriebe sinkt seit 10 Jahren kontinuierlich.
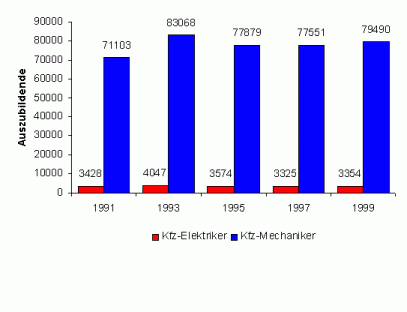
Die Zahl der Kfz-Elektriker ist trotz der gestiegenen "Elektronifizierung" nicht angestiegen.
Dies ist auch ein
Ausdruck der zusammengewachsenen Kfz-Systemtechnik, in der die Elektronik
nur noch Hilfsmittel zur Erfüllung der Systemfunktionen ist. Die
Fahrzeugelektronik wird inzwischen selbst von Fahrzeugingenieuren mit
Hilfe von Black-Box-Modellen betrachtet. Während allerdings der Ingenieur
der Blackbox Eigenschaften verleiht, ist es Aufgabe des Mechanikers, die
(Fehl-)Wirkungen im System und deren Ursachen zu verstehen.
Damit wären wir bei der
Frage angekommen, welche Rolle die Elektrotechnik bei der Ausbildung zum
Kfz-Mechaniker spielt. Die Fachsystematik der Elektrotechnik leitet z.B.
aus den Gesetzmäßigkeiten der Induktion die Funktion von Sensoren ab, die
auf diesem Prinzip basieren. Das ist aber nicht das Wissen, das der
Mechaniker für die Arbeit am Fahrzeug braucht. Er wendet nicht das
Induktionsgesetz auf das Bauteil Drehzahlsensor an, sondern misst den
Signalverlauf eines solchen Sensors am Fahrzeug und versucht, ihm seinen
„Sinn“ zu entlocken. Die physikalische Ursache für die verschiedenen
Signalverläufe lassen sich mit Hilfe des Induktionsgesetzes erklären und
jeder Physiker und jeder Ingenieur könnte dies tun. Das Wissen des
Facharbeiters macht aber demgegenüber aus, die richtigen Messwerkzeuge
auswählen zu können, die Messung am Fahrzeug zu planen und durchzuführen
und die von der Sollkurve (die alles andere als einheitlich ist)
abweichenden Werte zu bemerken. Bei einem Abweichen der Signalverläufe
muss er darüber hinaus in der Lage sein, die dafür verantwortliche Ursache
zu finden. Schließlich ist es seine Aufgabe, den verursachenden Defekt
abzustellen, sei es durch den Tausch bspw. des Drehzahlsensors oder durch
die Reparatur eines Masseschluss verursachenden Kabels. Diese Könnerschaft
ist doch letztlich das Herausragende an einem guten Mechaniker, oder
lassen sie ihren Physiklehrer ihr Auto reparieren?
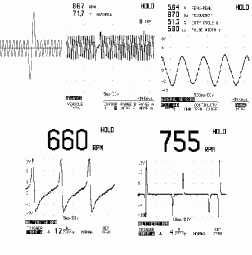
Wo liegt also der Weg des
gesunden Mittelmaßes zwischen Theorie und Praxis, den Olaf Fehrentz in der
Ausgabe 5/2001 des mot Profi einfordert?
An der Universität
Flensburg versuchen wir im Studium zum Berufsschullehrer das
Arbeitsprozesswissen zum Strukturelement zu machen. Die Lehrer sollen
dadurch in die Lage versetzt werden, im Unterricht ausgehend von
betrieblichen Problemstellungen z.B. das Erfahren der Ursachen für
Abweichungen von den Sollkurven zu thematisieren. Dazu müssen die realen
Gegenstände (das Auto, das Messgerät, die Kundenbeanstandung, die
Symptome), die realen Bedingungen (der erschwerte Zugang bei der Messung,
die unvollständige Information) und die Organisation der Arbeit in den
Mittelpunkt der Ausbildung rücken. Letzteres vor allem, um den
Bildungsaspekt gebührend zu berücksichtigen, in dem die Lösung von
Problemen und die Arbeitsaufgaben reflektiert werden können.
Bevor die Technikdetails
vermittelt werden, sollten die Arbeitsprozesse daher die wichtigste Rolle
spielen. Wir sprechen daher vom arbeitsprozessorientierten Lernen. Die
folgenden Bedingungen sollten auf jeden Fall beachtet werden, wenn ein
arbeitsprozessorientiertes Lernen befördert werden soll:
-
Lernort: Arbeitsplatz oder integrierter Fachraum. Die räumliche Trennung
zwischen Theorie und Praxis ist für ein arbeitsprozessorientiertes
Lernen hinderlich.
-
Projektorientiertes Lernen: Thematisch aufgebaute Lerninhalte führen zu
einem strukturierten Wissen, dessen Anwendungs- und Transferfähigkeit
stark in Frage gestellt werden muss. Demgegenüber steigert die
Orientierung an betrieblichen Problemstellungen nicht nur die Motivation
der Lernenden, sondern sorgt auch für ein „Erfahrung machen“, welches zu
einer Kompetenzentwicklung und nicht nur zu einem Wissenszuwachs bei den
Lernenden führt.
-
Lernorganisation: Eigenverantwortliches Lernen muss stark gefordert und
gefördert werden, damit nicht nur die Probleme gelöst werden, sondern
der Lerner die Probleme löst (ein gewaltiger Unterschied). Während der
Lösung von Problemen soll gelernt werden können.
-
Situationsadäquates Lernen: Unterstützung für ein
arbeitsprozessorientiertes Lernen sollte so angelegt sein, dass die
Lernsituationen möglichst nicht künstlicher Natur sind, sondern
Situationen aus dem Arbeitsprozess widerspiegeln. Für das Lernen im
Betrieb sollten die Situationen immer Realsituationen sein.
-
Die Lernmotivation entsteht beim arbeitsprozessorientierten Lernen aus
dem Arbeitsprozess heraus.
-
Lerninhalte: Arbeitsprozesswissen. Um ein arbeitsprozessorientiertes
Lernen zu fördern ist es unabdingbar, zu wissen, welches Wissen wie
während der Arbeit verwendet wird, um die Arbeitsaufgaben zu bewältigen.
Es ist sonst nicht möglich, Informationen in einer
arbeitsprozessgerechten Struktur bereitzustellen.
-
Lernen und Arbeiten werden gemeinsam unterstützt. Vor allem für das
betriebliche Lernen dürfen Lernen und Arbeiten nicht als Gegensatz
aufgefasst werden. Lernförderliche Strukturen können nur geschaffen
werden, wenn vermieden wird, dass Maßnahmen oder die Bereitstellung von
Unterstützung das Lernen oder das Arbeiten isoliert.
-
Multimediale Unterstützung: Informations- und Kommunikationstechnologien
wie das Internet sollten stets als Plattform verstanden sein und nicht
selbst zum Lernobjekt werden.
Matthias Becker