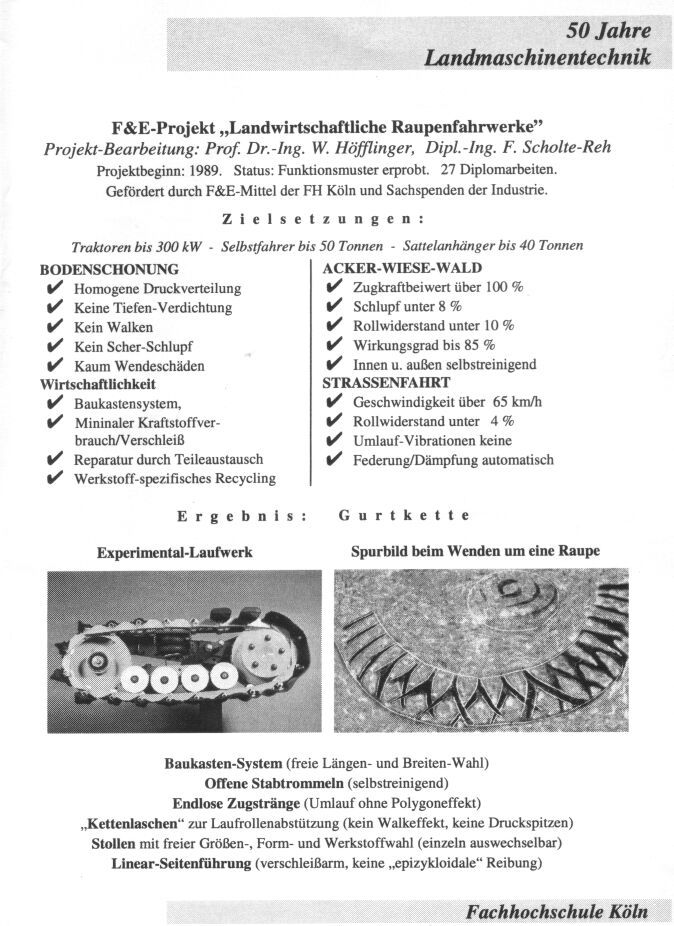
| www.kfztech.de |
Kraftschluss, ein Nobody in Kfz-Lehrbüchern |
Hans-Dietrich Zeuschner, 03.03
“Warum haben Rennwagen oder auch Ackerschlepper an den Triebrädern so
breite „Puschen“, wo doch die Reibung von der Größe der Auflagefläche nicht
abhängig sein soll?“
In vielen Fällen wird diese Schülerfrage im Unterricht
nicht sachgerecht beantwortet, denn man findet zwar in jedem Kfz-Lehrbuch
das Kapitel
Fahrwiderstand und den Abschnitt
Rollwiderstand, nicht dagegen die
Schlüsselbegriffe
Formschluss und Kraftschluss.
Dabei spielen beide Größen nicht nur in
der allgemeinen Metalltechnik / Fügetechnik dominierende Rollen sondern sind gleicher Maßen für die
Übertragung von Radumfangskräften in der Kfz-Technik verantwortlich (vgl.
Tabelle 1),
Der Rollwiderstand, eine Spezialform der Reibung,
eines Rades ist bekanntlich abhängig von
►
der Normalkraft FN, die auf das Rad wirkt,
sowie von der
Rollreibungszahl μR, die wiederum abhängt von
►
der Reibpaarung, z.B. Gummi / Asphalt
►
der Reifenbauart, -größe und dem Betriebszustand
►
der Umfangs- bzw. der Fahrgeschwindigkeit
Bei formschlüssigen Verbindungen
übertragen die Formschlussflächen
durch ihr gegenseitiges Anliegen das Drehmoment. Diese
Verbindungen können nie rutschen und haben keinen Schlupf, sie übertragen
Drehmoment und Bewegung zwangsläufig. Die Gurtkette gehört u.a. zu dieser Kategorie (siehe Bild 1).
Bei Kfz-Reifen ist der Anteil
Formschluss
je nach Bauart generell klein, z.B. bei Nkw-Winterreifen noch feststellbar, bei
Slicks praktisch vernachlässigbar.
Hier spielt der Kraftschluss die dominierende Rolle.
Der Kraftschlussbeiwert μK ist eine Funktion des Schlupfes,
abhängig von Art, Güte und Zustand der Fahrbahn sowie von den Reifenmerkmalen in
der Reihenfolge: Durchmesser – Profil – Innendruck (vgl. Bild 2).
Tabelle 1
Verbindungstechniken im Überblick
Stoffschlüssige Verbindungen Die Bauteile werden durch ein flüssiges Medium gefügt z.B. ═ durch Schweißen ═ durch Löten ═ durch Kleben
Formschlüssige Verbindungen Die Bauteile werden durch ein zusätzliches Element verbunden oder sie greifen a.G. der Form ineinander z.B. ╪ durch Stift ╪ durch Niet ╪ durch Schraube ╤ durch Feder ╤ durch Keil ◙◙ durch Zahnräder ◙| durch Zahnrad/Zahnstange ◙◙ durch Zahnriemen/Zahnräder ◙◙ durch Ketten/Kettenräder ◙◙ durch Gurtkette/Kettenräder
Kraftschlüssige Verbindungen Die Bauteile werden durch äußere Kräfte durch Reibung zwischen Flächen übertragen z.B. ►◄ durch Kupplung ►◄ durch Kegeltrieb ►◄ durch Flachriementrieb ►◄ durch Keilriementrieb ►◄ durch
Kfz-Triebräder
|
Bild 1 (FH Köln)
|
|
Bild 2 (Schulz,H.u.a.)
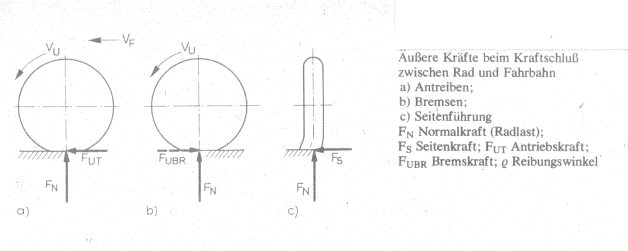
Ein unbelastetes Rad rollt
schlupffrei. Sobald jedoch eine
Umfangskraft übertragen wird, entsteht an einem rollenden Rad eines Fahrzeugs
Schlupf, d.h. Radumfangsgeschwindigkeit
und Fahrgeschwindigkeit differieren untereinander.
Beim treibenden Rad ist die Radumfangsgeschwindigkeit größer als die
Fahrgeschwindigkeit, im Grenzfall dreht das Rad durch, während die
Vorwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs gleich Null ist. Umgekehrt liegen die
Verhältnisse, wenn das Rad eines Fahrzeugs abgebremst wird. In diesem Falle ist
die Radumfangsgeschwindigkeit kleiner als die Fahrgeschwindigkeit. Im Grenzfall
blockiert das Rad (Umfangsgeschwindigkeit = 0) und das Fahrzeug rutscht.
Üblicherweise wird der Schlupf in Prozent angegeben, wobei man bei der
Definition das reine Rollen eines unbelasteten Rades gleich Null und
das Durchdrehen eines treibenden Rades bzw. das Blockieren eines bremsenden
Rades gleich Eins bzw.100% setzt. Feuchtigkeit
oder gar Flüssigkeit zwischen Rad und Fahrbahn mindern den
Kraftschluss
bis zum Aquaplaning.
Bild 3 (Schilling,E.)
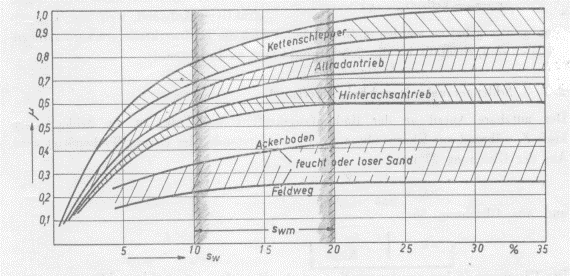
Erfahrungswerte von
Kraftschlussbeiwert
μK und Schlupf sw für
verschiedene Laufwerke auf landwirtschaftlich genutzten Böden
Bild 4 (Schilling,E.)
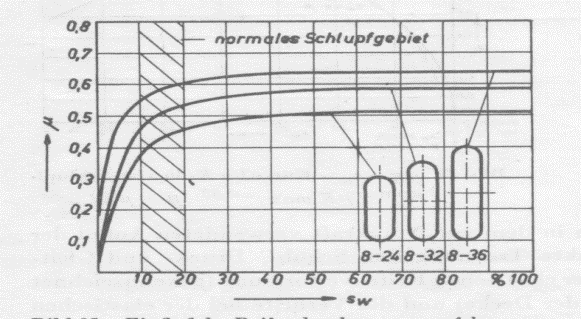
Einfluss des Reifendurchmessers auf den Kraftschlussbeiwert μK– Schlupf sw – Verlauf auf landwirtschaftlich genutzten Böden
Erläuterung: Reifenbezeichnung 8 – 24 bedeutet 8 Zoll Reifenbreite sowie 24 Zoll Felgendurchmesser
Die Kurven in den Bildern 3 und 4 gelten für die Kombination
Ackerschlepperbereifung / landwirtschaftlich genutzte Böden.
Oberhalb des nutzbaren Schlupfbereichs nähert sich die Kurve einem
asymtotischen Grenzwert. Die Ursache hierfür dürfte in der Tatsache
begründet sein, dass in diesem Fall
sowohl
Kraftschluss als auch ein geringerer
Anteil Formschluss wirksam ist.
Dagegen bezieht sich Bild 5 auf eine bestimmte
Kombination Nkw-Reifen / feste Fahrbahn. Unter den gegebenen Verhältnissen
steigt der Kraftschlussbeiwert bis zu einem Höchstwert an, um danach bei 100%
Schlupf beim Grenzwert
Kraftschlussbeiwert
μK =
Gleitbeiwert μG anzukommen (vgl. Bild 5a).
Aus diesem Zusammenhang erklärt sich der Einsatz von Traktionskontrollen
beim Start von Rennwagen.
Bild 5 (Schulz,H. u.a.)
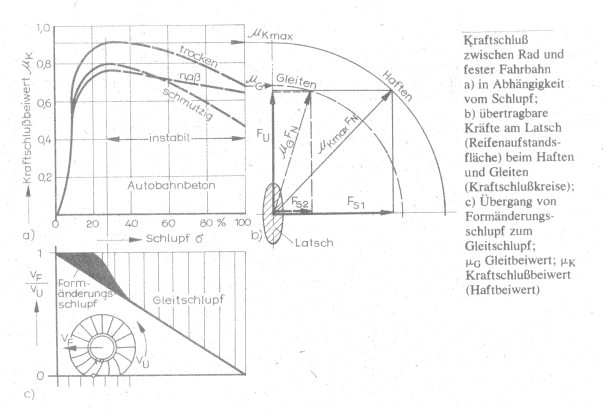
Bei einem angetriebenen Rad ist die Radumfangsgeschwindigkeit höher als die
Fahrgeschwindigkeit, verursacht durch die Elastizität des Reifens. Während der
Zeit, in der der Reifen mit dem Latsch an der Fahrbahn haftet, staut sich der
Reifenumfang vor dem Latsch und wird gleichzeitig dahinter auseinander gezogen.
Dadurch entsteht
Formänderungsschlupf
(Bild 5c), der bis zum Erreichen der Maximalwerte der
Kraftschlussbeiwerte (Bild 5a) überwiegt. Anschließend kann
der Kraftschlussbeiwert schnell
auf den Gleitbeiwert bei 100% Schlupf abfallen, mit dem Erfolg, dass das Rad
durchdreht oder blockiert, je nachdem ob angetrieben oder gebremst wurde. Die
übertragbare Gesamtkraft verringert sich, weil der Gleitbeiwert kleiner als der
maximale
Kraftschlussbeiwert ist (Bild 5b), in einer Formel ausgedrückt:
μG
. FN <
μKmax. FN
In
Bild 5b ist folgender Fall dargestellt:
Ein Fahrzeug wird bei
Seitenwind oder in einer leichten Kurve mit der Radumfangskraft FU
abgebremst. Die Reaktionskraft FS1 am Latsch ist zur Erhaltung der
Spurhaltung erforderlich. Beim Blockieren
der Räder, d.h. beim Überschreiten des maximalen Kraftschlussbeiwertes fällt die übertragbare Gesamtkraft von
μKmax . FN
auf μG
. FN
ab, die Folge: bei gleicher Bremskraft FU kann nur noch die deutlich
kleinere Seitenkraft FS2 übertragen werden. Sie reicht nicht aus, um
die seitliche Störkraft auszugleichen – das Fahrzeug schleudert, weil die
überbremsten Räder ihre Spurhaltung
verlieren.
Tabelle 2 Kraftschlussbeiwerte im Vergleich
|
Kraftschlussbeiwert μK |
||
|
bei 10 % Schlupf ( nach Schulz,H.) |
||
| trocken | nass | |
| Beton | 0,6 bis 0,9 | 0,4 bis 0,7 |
| Asphalt | 0,6 bis 0,8 | 0,3 bis 0,7 |
| Erdweg | 0,4 bis 0,5 | um 0,3 |
| bei 20 % Schlupf (nach Kirnich,G.) | ||
| Betonstraße | bis 1,0 | |
| Guter Feldweg | 0,7 | |
| Trockener, festgefahrener, lehmiger Ton | 0,6 bis 0,7 | |
| Trockener, normaler Ackerboden | 0,4 bis 0,5 | |
| Grasnarbe, Stoppel geschält | 0,35 bis 0,45 | |
| Sehr feuchter, sandiger Lehm, geschält | 0,25 bis 0,35 | |
| Feuchter, anmooriger Sand | 0,23 bis 0,32 | |
| Nasser, toniger Lehm | 0,15 bis 0,25 | |
| Feuchtes, lockeres Hochmoor | 0,15 bis 0,25 | |
Schlussbemerkung
Dieser Beitrag
ist horizontal und vertikal auf das Berufsschulniveau reduziert worden. Über
dieses Niveau hinaus gehendes
Informationsmaterial
ist bei Reifenherstellern, z.B. bei der Fa. Continental AG Hannover,
erhältlich.
Verwendete Literatur:
Hrg. Fa. Continental AG: Informationsmaterial, Hannover 2002
Kirnich,G.: Traktor Lexikon, Würzburg 1979
Schulz,H. u.a.: Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Krane, Berlin 1987
Schilling, E.: Landmaschinen, Band Ackerschlepper, Köln 1955
Hrg. Verlag Europa-Lehrmittel: Tabellenbuch Kraftfahrzeugtechnik Haan-Gruiten 2000
Hrg Verlag Europa-Lehrmittel: Fachkunde Metall, Haan-Gruiten 1997
Weitere Seiten von Herrn Zeuschner finden Sie hier
Der Fachbeitrag wurde weder gekürzt noch inhaltlich verändert. Wiesinger
bearbeitet am:
Wiesinger